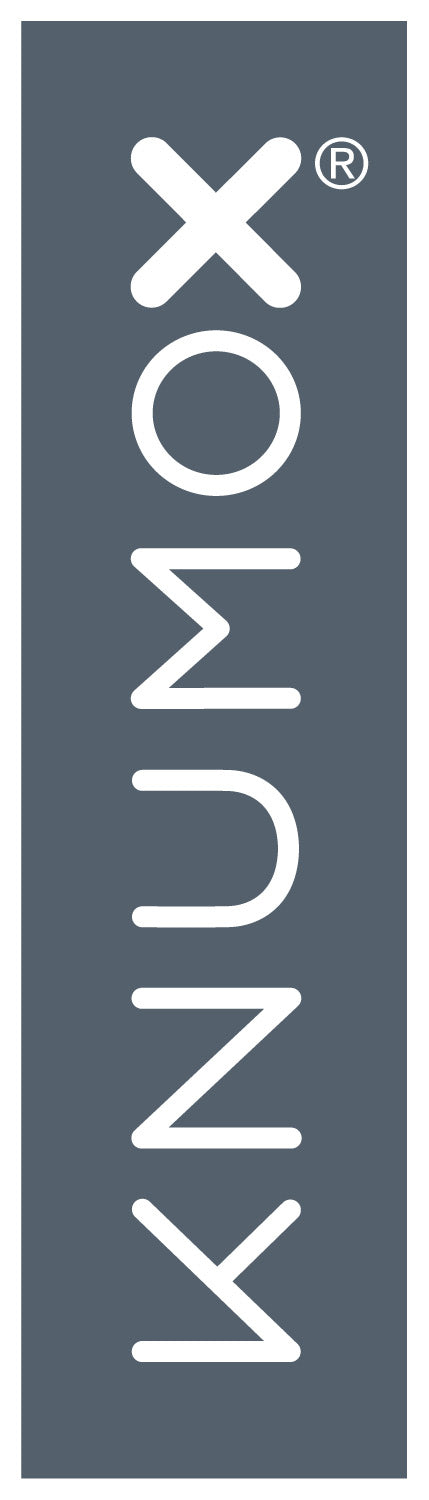2 LUXURISIERUNG UND NACHHALTIGKEIT
2.1 Luxus – Definition, Entwicklung, Status quo und Ausblick
Der Duden definiert Luxus als: „kostspieliger, verschwenderischer, den normalen Rahmen (der Lebenshaltung o. Ä.) übersteigender, nicht notwendiger, nur zum Vergnügen betriebener Aufwand; Pracht, verschwenderische Fülle“ (Dudenredaktion 2022). An dieser Stelle sei erwähnt, dass die (europäischen) Nachbarländer Luxus, im Gegensatz zur deutschen Definition, als etwas Positives interpretieren. Im englischen Verständnis von Luxus gibt es den Aspekt der Leichtigkeit und des Komforts. Im Italienischen, Spanischen und Französischen kommen Schönheit und Genuss hinzu (Fastoso 2021, S. 15).
Luxus gilt schon immer als eine irrationale Form des Konsums – ein meist hochemotionaler Prozess, der sich besonders in wirtschaftlich stabilen Zeiten nicht ausschließlich an monetärer Liquidität festmacht. Luxus braucht man nicht, Luxus muss man wollen. Nicht zuletzt deshalb scheint sich die Definition und Phänomenologie von Luxus regelmäßig neu zu finden (Zukunftsinstitut 2017). Grundsätzlich besteht die Funktion des Luxus darin, das sozial Trennende elitär zu betonen. Luxus bietet die Möglichkeit einer sozialen Selektion – und damit einer puren Provokation (Müller und Hoffmann 2022). Die Luxusmarke schafft hierfür eigene Wertevorstellungen und demonstriert zugleich die Zugehörigkeit des Konsumenten zu einer sozialen Klasse als Status- und Prestigefunktion (Garth 2005). Weitere wichtige Faktoren sind u.a. die Einzigartigkeit der Produkte, ihre sehr hohe Qualität und Kreativität sowie der sehr hohe Preis, den der Nachfrager für sie entrichten muss (Burmann et al. 2012, S. 156).
Jedoch steht der Luxusmarkt, in seiner bisherigen Form, massiven Veränderungen gegenüber, welche das Potential besitzen den Markt zu transformieren (Müller und Hoffmann 2022). Denn aktuell vollzieht sich eine große Veränderung von Luxus-Verständnis, Luxus- Bedürfnissen und Luxus-Geschäftsmodellen. Zu den wesentlichen Treibern gehören die folgenden:
• Demokratisierung:
Insbesondere seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führte die Demokratisierung zu gesellschaftlich flacheren Hierarchien – und damit zu einem Autoritätsverlust des Luxus als Symbol von Herrschaft. Ein zu öffentlicher Luxuskonsum der politischen und wirtschaftlichen Eliten wirft schnell die unerwünschte Frage ihrer (politischen) Legitimität auf. Die Sanktionierung russischer Oligarchen in Folge des Ukraine-Krieges kann hier als aktuelles Beispiel genannt werden. Der Luxus-Konsum wird breitenwirksamer. Befeuert durch die gute Konjunktur der vergangenen Jahre, bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019, leisteten sich immer mehr Gesellschaftsschichten einen gewissen Luxus (Zukunftsinstitut 2017).
• Moral & Ethik:
Unüberlegter Konsum hat einen enormen Beitrag zu Umweltschäden, CO2-Emissionen aber auch zur Klimapolitik geleistet. Beispielsweise erlebte die Generation der Babyboomer (ca. 1945 – 1964) den wirtschaftlichen Aufschwung und Aufbruchsstimmung. Das Ergebnis: Luxus wurde als materielles Gut verstanden – als Haus, Auto oder Uhr (Abdollahi 2022a). Gerade junge Menschen stellen sich deshalb vermehrt die Frage, ob in Anbetracht knapper werdender natürlicher Ressourcen Luxuskonsum als ein Symbol von Ubiquität und Verschwendung überhaupt noch vertretbar ist (Müller und Hoffmann 2022).
Für Millennials (ca. 1980 - 1995) und die Generation Z (ca. 1996 2012) hat der Luxus-Begriff längst nicht mehr die Bedeutung eines Statussymbols.
Er bezieht sich auf einen Lifestyle und den Wunsch Hochqualitatives zu besitzen, das nicht im Konflikt mit der Natur oder der Würde des Menschen steht. Es geht um einen holistischen Ansatz, bei dem Luxus auch bedeutet, positiven Wandel voranzutreiben. Dieser Shift der Luxus-Definition orientiert sich so immer mehr an Normen und Werten. Auf diese Weise bedeutet der Konsum von Luxus nicht nur einen persönlichen Mehrwert, sondern auch Vorteile für den Planeten und die Menschen (Abdollahi 2022a).
Es gilt für Unternehmen sich mit dieser neuen Zielgruppe und Ihren Wertevorstellungen vertraut zu machen, denn die Kunden der Generation Y werden bis zum Jahr 2025 ca. 45 % des Marktes und die Generation Z bis zum Jahr 2035 ca. 40 % der Umsätze aller Luxuslabels weltweit ausmachen (Misakian 2022).
Die Generation Y und Generation Z werden den Luxusmarkt dominieren, dabei werden disruptive Verbrauchertrends (bspw. Sharing- und 2nd-Life-Geschäftsmodelle) (Abdollahi 2022b) von diesen jüngeren Generationen vorangetrieben (D‘Arpizio et al. 2020).
• Covid-19:
Die weltweite Pandemie verursachte eine beispiellose Reduzierung des Luxusmarktes.
Der weltweite Markt – der sowohl Luxusgüter als auch Luxuserlebnisse umfasst – ist um ca. 20 % bis 22 % geschrumpft und wird aktuell weltweit auf etwa eine Billion Euro geschätzt, zurück auf das Niveau von 2015.
Der Zusammenbruch des Tourismus sowie die Restriktionen im Handel führten in Europa zu einem Rückgang von 36 % auf 57 Milliarden Euro (D‘Arpizio et al. 2021). Zudem hat die Pandemie auch zu einer beschleunigten Schrumpfung der Mittelschicht in Deutschland geführt. In den vergangenen Jahren sind bereits viele Menschen vom unteren Rand der Mittelschicht in die Armut abgerutscht, jedoch haben insbesondere durch die Pandemie auch Personen mit mittlerem Einkommen Ihren Job verloren und sehen sich nun mit diesem Risiko konfrontiert (Consiglio et al. 2021). Auf der anderen Seite führte die Corona-Pandemie bei Personen aus der Mittel- und oberen Mittelschicht eher dazu, in die eigene Immobilie, oder aber in den Garten zu investieren (Amaya 2020; Haymarket Media GmbH 2021).
• Russland-Ukraine-Krieg:
Der Russland-Ukraine-Krieg hat bereits jetzt (November 2022) massiven Einfluss auf die deutsche Konjunktur. Der Inflationsdruck wächst stetig und es kommt zu massiven Störungen in den Lieferketten, welche wiederum zu immensen Rohstoffpreisen führen. Schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine waren Sprit- und Heizkosten wegen der starken Nachfrage nach Öl und Gas im Zuge der weltweiten Konjunkturerholung gestiegen und haben die Inflation weiter angeheizt (RND 2022; Handelsblatt GmbH 2022). Die bereits zuvor hohen Strompreise haben sich ebenfalls, im Zuge der Entwicklungen, weiter erhöht, mit drastischen Folgen: Erste Unternehmen führen Produktionsstopps bzw. das Abstellen von Produktionslinien ein (Stratmann 2022). Die hohen Preise drücken die Verbraucherlaune in Deutschland massiv. Damit droht der private Konsum, auch von Luxusartikeln, als wichtige Stütze für die Erholung der Konjunktur vorerst auszufallen (ntv Nachrichtenfernsehen GmbH 2022). Es wird angenommen, dass der Russland-Ukraine-Krieg zu einem weltweiten Umsatzrückgang von Luxusartikeln um etwa 2-3 % führen könnte (Ferraro 2022; Block 2022). Die langfristigen Folgen für den globalen Markt sind jedoch noch nicht absehbar und unmittelbar mit der Dauer des Konflikts verbunden.
• Online vs. Offline: Weltweit nahm der Onlinevertrieb von Luxusartikeln zu und macht aktuell einen Marktanteil von nun 12 % des globalen Marktes aus. Es wird davon ausgegangen, dass der Anteil an physischen Geschäften nicht weiter oder nur im geringen Maße wachsen wird (D‘Arpizio et al. 2020). Darauf reagiert der Luxusmarkt mit einer Öffnung für die Masse.
Die sogenannten “Masstige“-Linien (zusammengesetzt aus Masse und Prestige) setzen auf Luxus für eine möglichst breite Käuferschaft. Es werden Produkte angeboten, die einer breiteren Kundschaft ermöglichen, sich mit einem Hauch von Exklusivität zu umgeben.
Der Masstige-Markt stellt damit neue Anforderungen an Qualität, Status und Reichweite und setzt die großen Luxusinstanzen unter Druck. Mithilfe ausgeklügelter digitaler Präsenz werden die Produkte jedem zugänglich gemacht und exklusive Angebote auf verschiedenen Plattformen machen auch die klassischen Luxusmarken näher und erreichbarer. Der selbstgeschaffene Kunden-Filter, etwa die Befürchtung, vom Verkäufer im Laden skeptisch beäugt zu werden, spielt online keine Rolle mehr. Luxus –
in Form von exklusiven Produkten – wird damit paradoxerweise alltagstauglicher und löst sich immer mehr von der Potenz exklusiver Eliteschichten, hin zu einem milieuübergreifenden und geöffneteren Luxusmarkt (Zukunftsinstitut 2017).
Die Herausforderungen, aber auch insbesondere das Potential, der zuvor aufgeführten Aspekte führen zu folgenden Entwicklungen am Markt für Luxusartikel:
• New Luxury: Luxury (Erlebnisluxus und Demokratisierung von Luxuskonzepten) steht als Antipode zum Old Luxury (Objekt- und Besitzluxus) für die Suche von Menschen nach Zeit, Geborgenheit, Beziehung, qualitativ erfülltem Leben, verinnerlichtem, stillen Konsum, der sich nicht an der Höhe des Warenpreises misst – soweit handfeste Waren überhaupt noch involviert sind (Müller und Hoffmann 2022; New Business Verlag GmbH & Co. KG 10.02.2020). Moralisch-ethisch korrektes Verhalten hat sich nicht nur als gesellschaftlicher Wert durchgesetzt, sondern wird zu einem käuflichen Luxusgut. Künftig sind es zunehmend immaterielle Werte, die als besonders begehrenswert gelten (Pogorelova 2016). Hierbei sind die folgenden Konzepte Treiber dieses neuen Luxus-Verständnisses (Abdollahi 2022a, 2022b; Fastoso 2021, S. 8–9):
• Sharing- und 2nd-Life-Geschäftsmodelle: nutzen von Leihdiensten (z.B. Carsharing), Resale- oder Secondhand-Plattformen
• Membership & Experience: mit inspirierenden Persönlichkeiten verbinden und das Sozialkapital durch exklusive Netzwerke erweitern
• Wissen & Transparenz: ein nachhaltiges Mindset fordert radikale Transparenz von Marken, Konsumenten wollen wissen welche Versprechungen gemacht und auch eingehalten werden
• Individualisierung: die komplett individualisierte Produktion von Luxusprodukten für die individuellen Bedürfnisse des Konsumenten
• Digitalisierung: durch exklusive, personalisierte Marketing-Erlebnisse und E-Commerce-Funktionen wird Luxus digital erlebbar und konsumierbar
• Nachhaltigkeit: Wunsch Hochqualitatives zu besitzen, das nicht im Konflikt mit der Natur oder der Würde des Menschen steht
• Gesundheits- und Achtsamkeitstrend: holistisches Wellbeing. Körper, Seele und Geist sollen im Einklang miteinander stehen
Es ist festzuhalten, dass ein steigender Anteil an Luxuskonsumenten sein Verhalten von „conspicuous consumption” (Prestigekonsum) zu „conscientious consumption” (Gewissenhafter Konsum) verändert, also einem Konsumverhalten, das einen Sinn für Umweltbelange und soziale Verantwortung ausdrückt.
Das Konsumverhalten der Nachfrager bildet in der Regel die Ausgangsbasis für strategische bzw. operative Entscheidungen des Marketingmanagements. Speziell im Rahmen des Nachhaltigkeitsmarketings kann von einem starken Einfluss der Nachfrager auf den Ökologisierungsprozess auf Anbieterseite und somit auf die marketingpolitischen Entscheidungen ausgegangen werden (Prüne 2013, S. 35). Prognosen gehen davon aus, dass sich insbesondere die Zielgruppe der LOHAS, die über eine hohe Kaufkraft verfügt und diese in Luxus und Genuss investiert, welcher jedoch ethisch vertretbar sein muss, zukünftig weiter vergrößern wird (Thieme 2017; Pufé 2017, S. 71). Als potenziell wichtigste Zielgruppe wird dieser, und angrenzenden Zielgruppen, das Kapitel 3 gewidmet.
Inwieweit die Corona-Pandemie und zuletzt der Russland-Ukraine-Krieg ihre Wirkung entfalten werden, bleibt weiterhin abzuwarten. Ersten Berichten zufolge zeichnet sich jedoch bereits wieder ein Aufschwung bei Luxusmarken in Form von Rekordumsätzen für das erste Halbjahr 2022 ab (Kröger 2022). Wie jedoch bereits angedeutet, sind die ersten spürbaren Konsequenzen, insbesondere für Unternehmen und Verbraucher in Deutschland, eingetreten. Unabhängig hiervon wird deutlich, dass das Verständnis und die Wahrnehmung des Themas Luxus einem Wandel unterlaufen, dessen Ende noch nicht absehbar ist. Verdeutlicht werden konnte der Einfluss, welche die zukünftigen Luxus-Konsumenten auf den Markt haben werden, sodass mit einer veränderten Bedürfnis- und Konsumstruktur zu rechnen ist, auf welche die Anbieterseite mit einer entsprechenden Anpassung ihrer Leistungen reagieren muss (Prüne 2013, S. 207). Insbesondere der Faktor Nachhaltigkeit gilt hier als nicht zu vernachlässigender Treiber der weiteren Entwicklungen im Luxussegment, welcher für eine dauerhafte Veränderung der unternehmerischen Rahmenbedingungen sorgt bzw. sorgen wird. Daher wird dieser Themenkomplex im folgenden Unterkapitel noch einmal näher betrachtet.
2.2 Nachhaltigkeit – Definition, Entwicklung, Status quo und Ausblick
Der Begriff der Nachhaltigkeit beschreibt in seinem ursprünglichen Sinn die Nutzung eines regenerierbaren natürlichen Systems in einer Weise, dass dieses System in seinen wesentlichen Eigenschaften erhalten bleibt und sein Bestand auf natürliche Weise nachwachsen kann (Pufé 2017, S. 37). Oder um es eingängiger in Anlehnung an Carl von Carlowitz – sächsischer Oberberghauptmann und Schöpfer des Begriffs Nachhaltigkeit – zu formulieren: Es darf nur so viel Holz geschlagen werden, dass sich der Wald regenerieren kann und dauerhaft zur Holzgewinnung zur Verfügung steht und somit nachhaltend Rohstoffe für den Wohlstand liefert.
Von dieser ursprünglichen Definition wurde das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit abgeleitet. Diesem Modell nach erfordert Nachhaltigkeit gleichermaßen die Einhaltung ökologischer, ökonomischer sowie sozialer Anforderungen. Ökologische Nachhaltigkeit hat dabei zum Ziel, die Umwelt zu schonen. Damit entspricht sie am ehesten dem klassischen „grünen“ Denken. Wichtigster Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit ist die Vermeidung von Raubbau an der Umwelt. Hierzu dürfen die natürlichen Lebensgrundlagen nur in dem Maße beansprucht werden, in dem sie sich auch auf natürliche Weise wieder regenerieren können. Ökonomische Nachhaltigkeit fordert ein Wirtschaften, das nicht über die gegebenen Verhältnisse hinausgeht, um den Wohlstand auch für nachfolgende Generationen zu erhalten. Soziale Nachhaltigkeit zielt darauf ab, dass ein friedliches und ziviles Zusammenleben zwischen allen Beteiligten möglich ist (Burmann et al. 2012, S. 156). Es gibt drei Strategien, die darauf hinarbeiten, Nachhaltigkeit zu erreichen. Diese Strategien sind Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Zusammengefasst lassen sich die drei Prinzipien wie folgt beschreiben:
-
1. Effizienz:
Sie richtet sich auf eine ergiebigere Nutzung von Materie und Energie, also auf Produktivität von Ressourcen aus.
-
2. Konsistenz:
Sie richtet sich auf naturverträgliche Technologien, welche die Stoffe und die Leistungen der Ökosysteme nutzen, ohne sie zu zerstören aus.
-
3. Suffizienz:
Sie richtet sich auf einen geringeren Ressourcenverbrauch durch eine Verringerung der Nachfrage nach Gütern aus.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass auch bei konsequenter Anwendung aller drei Prinzipien nicht alle Felder der Nachhaltigkeit abgedeckt sind.
Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung im Jahr 2012 beschlossen die UN-Mitgliedsstaaten die Entwicklung weltweit geltender konkreter Ziele für mehr Nachhaltigkeit. Diese sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs) sind in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen festgeschrieben und gelten seit 2016. Mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wurden die Nachhaltigkeitsziele in ein nationales Konzept für Deutschland überführt. Ihre 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (die Sustainable Development Goals) berücksichtigen alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales. Zentrales Element der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sind die 72 sogenannten „Schlüsselindikatoren“. Die Indikatoren sind meist mit quantifizierten Zielen verbunden. Zu jedem der 17 SDGs wird mindestens ein durch einen Indikator messbares Ziel definiert (Müller et al. 2022). Die Komplexität und Quantität der SDGs kann schnell zu einer Herausforderung werden. Daher bietet es sich insbesondere für KMU an, sich dem Thema Nachhaltigkeit mit dem DNK – dem deutschen Nachhaltigkeitskodex – zu nähern. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex ist ein branchenübergreifender Transparenzstandard für die Berichterstattung unternehmerischer Nachhaltigkeitsleistungen und kann von Unternehmen und Organisationen jeder Größe und Rechtsform genutzt werden. Die klare Struktur und die
Konzentration auf die wesentlichen Kriterien stellen zentrale Vorteile des DNK dar. Sie fördern die Vergleichbarkeit der Angaben.
Aktuell sind in Deutschland nur börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und mehr als 40 Millionen Euro Jahresumsatz zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet.
In ihrem Lagebericht oder in einem gesonderten Nachhaltigkeitsbericht müssen sie offenlegen, inwieweit sie als Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung (Corporate Social Responsibility) gerecht werden. Darunter fällt nicht nur der Umweltschutz, sondern auch der Arbeitnehmerschutz, Korruptionsbekämpfung, der Schutz der Menschenrechte und der Diversität. Einen solchen CSR-Bericht müssen auch Banken und Versicherungen mit über 40 Millionen Euro Jahresumsatz abliefern.
Der im April 2021 von der EU-Kommission vorgelegte Entwurf zur CSRD ändert den Umfang und die Art dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen tiefgreifend. Mit der CSRD werden bestehende Regeln zur nicht-finanziellen Berichterstattung erheblich erweitert. Alle an einem EU-regulierten Markt notierten Unternehmen (mit Ausnahme von Kleinstunternehmen) sind von der neuen Berichtspflicht erfasst. Zudem sind alle nicht kapitalmarkt-orientierten Unternehmen von der CSRD erfasst, wenn sie zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen:
• Bilanzsumme > 20 Mio. Euro
• Nettoumsatzerlöse > 40 Mio. Euro
• Zahl der Beschäftigten > 250
Die neue CSR-Richtlinie folgt einer doppelten Wesentlichkeitsperspektive („Double Materiality“). Das heißt, Unternehmen müssen die Wirkung von Nachhaltigkeitsaspekten auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens festhalten. Und sie müssen die Auswirkungen des Unternehmens auf Nachhaltigkeitsaspekte verdeutlichen. Die CSRD fordert in der Berichterstattung Angaben zu:
• Nachhaltigkeitszielen,
• der Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat,
• den wichtigsten nachteiligen Wirkungen des Unternehmens und
• zu noch nicht bilanzierten immateriellen Ressourcen.
Schätzungsweise wären damit rund 50.000 Unternehmen in der EU betroffen, davon allein 15.000 nur in Deutschland. Die CSR-Richtlinie soll ab dem 01.01.2024 für das Geschäftsjahr 2023 Anwendung finden. Zusätzlich sollen kleine und mittlere Unternehmen ab zehn Mitarbeitern ab ca. 2026 zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden (Mazar 2022).
Auch ein Blick auf die EU-Taxonomie – welche Teil des “Sustainable Finance Frameworks” der Europäischen Union ist – zeigt, welche Herausforderungen kleine- und mittelständische Unternehmen zukünftig erwarten. Die EU-Taxonomie schafft verbindliche Definitionen, was als nachhaltiges Wirtschaften gilt. Verbunden damit sind konkrete Anforderungen sowohl an Unternehmen als auch an Banken und deren Kapitalmarktprodukte. Die EU-Taxonomie ist ein gemeinschaftliches Klassifizierungssystem für den EU-Wirtschaftsraum, das festlegt, welche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig angesehen werden (Neitz-Regett et al. 2022). Auch wenn bisher die Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus von der Berichterstattungspflicht nicht betroffen sind, so ergeben sich durch die EU-Taxonomie dennoch folgende Herausforderungen.
Banken und die aktuell bereits berichtspflichtigen Unternehmen können die an sie gestellten Anforderungen bezüglich der Nachhaltigkeitsberichterstattung auch an ihre Zulieferer weiterleiten. Denn um Kennzahlen berechnen oder die eigene Taxonomie-Konformität umfassend beurteilen zu können, benötigen sie deren Daten (z. B. für die Beurteilung der Wertschöpfungskette). Des Weiteren kann der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für kleine- und mittelständische Unternehmen erschwert werden, bzw. Darlehen können sich verteuern. Dies hängt damit zusammen, dass die Banken die Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, nach den neuen Kriterien der EU-Taxonomie, als nicht ausreichend nachhaltig einstufen könnten (Fischer 2021; Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. 2021).
Es ist daher damit zu rechnen, dass sich auch Garten- und Landschaftsbauunternehmen in Zukunft auf die Pflicht einer – wenn auch vereinfachten – Nachhaltigkeitsberichterstattung einstellen müssen, welche wiederum zur Folge hat, dass das Thema Nachhaltigkeit im Kontext der jeweiligen Unternehmen möglichst zeitnah aktiv bearbeitet werden sollte.
An dieser Stelle sei jedoch auch auf die Vorteile eines nachhaltig wirtschaftenden Unternehmens hingewiesen, denn neben aktuell vielen Herausforderungen stellt das Thema Nachhaltigkeit auch einige herausragende Vorteile für Unternehmen bereit, welche hier nur auszugsweise dargestellt werden:
• viele Kunden kaufen lieber von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen > stärkere Kundenbindung (Sympathie)
• bestehende und künftige Mitarbeiter legen Wert auf Umweltfreundlichkeit > positives Employer-Branding
• der ökologische Fußabdruck des Unternehmens wird verringert
• nachhaltige Unternehmen sind generell auf Langlebigkeit ausgerichtet
• mit nachhaltigen Technologien wie Ökostrom oder Photovoltaik kann durch Energieeffizienz Geld gespart werden
• viele Kunden sind bereit, höhere Preise zu akzeptieren, wenn das Produkt aus einem nachhaltigen Anbau oder einer nachhaltigen Produktion stammt
• nachhaltige Unternehmen oder Unternehmen, die in die Nachhaltigkeit investieren, können Fördermittel erhalten oder aber besondere Kosten steuerlich absetzen
Die individuellen Vor- und Nachteile einer nachhaltigkeitsorientierten Ausrichtung sind in Abhängigkeit des jeweiligen Unternehmens zu bewerten. Dennoch wird deutlich, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur aus regulatorischer Perspektive, sondern auch Konsumentenperspektive eine hohe Relevanz aufweist. Im Kontext der Studie stellt sich jedoch die Frage, wie sich das Thema Luxus und Nachhaltigkeit vereinen lassen, scheint es sich doch um zwei Konzepte zu handeln, die sich anscheinend diametral und unvereinbar gegenüberstehen?
2.3 Luxus und Nachhaltigkeit – wie passt das zusammen?
Letztendlich hängt die Auffassung, was unter Luxus zu verstehen ist, vom jeweiligen individuell ausgeprägten Werte-Set ab, welches wiederum vom Werteumfeld der Gesellschaft beeinflusst wird (Thieme 2017).
Die vorangegangenen Ausführungen zeigen auf, dass die aktuell relevante Zielgruppe zunehmend zerfällt. Innerhalb dieses Fragmentierungsprozesses zeichnet sich aufgrund von elementaren soziokulturellen Umwälzungen eine zunehmende Akzeptanz und Befürwortung des Nachhaltigkeitsprinzips ab, welche in einem Bedürfnis nach entsprechenden Konsumformen münden:
„Luxusmarken sind zugänglicher geworden, dadurch ist es schwieriger geworden, die Verbraucher mit dem Argument der Exklusivität anzusprechen. Stattdessen könnte ihr Mehrwert für die Verbraucher in einer besseren Umwelt- und Sozialleistung liegen, die sich durch „tiefere“ Markenwerte und nachhaltigere Geschäftspraktiken auszeichnet.“ (Prüne 2013, S. 362)
Somit stellt Nachhaltigkeit keinen zusätzlichen Aspekt des wirtschaftlichen Handelns dar, sondern ist vielmehr der Kern des eigenen Selbstverständnisses. Die Verschmelzung von Nachhaltigkeit und höchsten Ansprüchen an die eigenen Produkte, auch über den „grünen“ Aspekt hinaus, bilden die Grundlage einer hohen Glaubwürdigkeit des Handelns und stellen das Fundament für einen authentischen Auftritt dar (Burmann et al. 2012, S. 161). Durch eine konsequente Umsetzung eröffnen sich zahlreiche Potentiale, die von der Differenzierung des
Angebots bis zur Abschöpfung eines erweiterten Premiumpreises reichen (Burmann et al. 2012, S. 164). Im marktorientierten Wettbewerb, sowohl im Luxussegment als auch im Gesamtmarkt, konnte eine aus Richtung Nachhaltigkeit initiierte Dynamik identifiziert werden. Die Folge dieser Entwicklung ist ein Trend zu Überschneidungen der bisher getrennten Marktsegmente, sodass sich auch das Wettbewerbsspektrum für den einzelnen Anbieter – sowohl im konventionellen als auch im sozialökologischen Segment – erweitert (Prüne 2013, S. 361).
Als Beispiel der Verbindung von Luxus und Nachhaltigkeit lässt sich die bereits erwähnte Suffizienzstrategie aufzeigen, die mit einer Konsumzurückhaltung im Sinne von „weniger Quantität, dafür aber mehr
Qualität“ gleichzusetzen ist.
Als weitere zentrale Ansatzpunkte für die Verbindung der beiden Konzepte können die wesensprägenden Luxusmerkmale wie hohe Designqualität, Langlebigkeit sowie Zeitlosigkeit angenommen werden. Die Wegwerfmentalität, die vielen Nicht-Luxusprodukten zu eigen ist und durch deren Hersteller z. T. sogar befördert wird (geplante Obsoleszenz) trifft auf Luxusprodukte im Allgemeinen nicht zu.
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über Anknüpfungspunkte zwischen den beiden Konzepten Luxus und Nachhaltigkeit, insbesondere in Bezug auf deren Produkteigenschaften (Thieme 2017, S. 514). Sie dient als Grundlage für die weiteren Ausführungen in den nachfolgenden Kapiteln.
Tabelle 1: Merkmale nachhaltiger Luxusobjekte
-
Merkmal
-
Luxus
-
Nachhaltigkeit
-
Nachhaltige Luxusobjekte
-
Exzellente
Qualität -
• Hochwertigkeit der Materialien
• Hohe Sorgfalt bei der Herstellung
• Langlebigkeit verbunden mit langem After-Sales-Service -
• Qualitativ hochwertige, weil ursprüngliche, sozial- und umweltverantwortungsvolle Herstellung
-
• Langlebigkeit bei hoher Produktqualität, die zugleich von einer hohen Sozial- und Umweltverträglichkeit der Produkte gekennzeichnet ist
-
Hoher Preis
-
• Konsequenz aus exzellenter Qualität sowie aufgrund der Exklusivität bzw. Einzigartigkeit/ Knappheit
-
• Höhere Preise als vergleichbare nichtnachhaltige Produkte aufgrund aufwendigerer Herstellung, der Einhaltung hoher Sozial- und Umweltstandards sowie geringerer Stückzahlen
-
• Nachhaltigkeit als zusätzliche Legitimation für den hohen Preis gegenüber dem sozialen Umfeld
• Zahlungsbereitschaft für gutes Gewissen
• Prestigesteigerung durch höhere Preise
-
Exklusivität
-
• Bedingt durch hohes Qualitätsniveau (Handarbeit, hochwertige Rohstoffe), hohe Preise und erschwerte Zugänglichkeit in der Distribution
-
• Bedingt durch aufwendigere Herstellung und geringere Stückzahlen
• exklusive Verfügbarkeit: Regionalität, Saisonalität -
• Steigerung der Exklusivität der Verfügbarkeit nachhaltiger Luxusprodukte aufgrund der durch die Nachhaltigkeitsorientierung erhöhten Anforderungen
-
Ästhetik
-
• Verfeinertes sinnliches Erlebnis, Schönheit und außergewöhnliches Design der Produkte
-
• Schönheit der Natürlichkeit und Ursprünglichkeit
-
• Natürlichkeit als authentische Form der Ästhetik
-
Tradition
-
• Lange Markentradition und kulturelle Verankerung
-
• Authentizität und Ursprünglichkeit
-
• Rückbesinnung auf Tradition und ursprüngliche Herkunft
-
Nicht-
Notwendigkeit -
• Hauptnutzen durch symbolische Selbstergänzung, Selbstverwirklichung, Genuss, Distinktion
-
• Nachhaltigkeit als non-funktionaler Nutzen
• Bedürfnis zu altruistischem Handeln
• Bedürfnis nach gutem Gewissen -
• Nachhaltigkeit als zusätzliche Nutzendimension: Beitrag für Gesellschaft und Umwelt
• Ideeller Zusatznutzen durch gutes Gewissen
2.4 Zusammenfassung
• Luxus wurde und wird als der Besitz kostspieligen materiellen Gutes verstanden. Die Einzigartigkeit des Produktes, die sehr hohe Qualität und der hohe Preis garantierten dem Besitzer Status- und Prestige sowie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Klasse.
• Die Auffassung, was unter Luxus zu verstehen ist, hängt vom jeweiligen individuell ausgeprägten Werte-Set ab, welches wiederum vom Werteumfeld der Gesellschaft beeinflusst wird.
• Die Demokratisierung des Luxus seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das Bewusstsein für Moral und Ethik bei jüngeren Konsumgruppen, die Corona-Pandemie, der Russland-Ukraine-Krieg sowie das Online- bzw. Offline-Kaufverhalten der Konsumenten führen jedoch zu massiven Veränderungen im Luxussegment.
• Als Folge dessen entwickelte sich das Konzept des New Luxury. So werden Sharing- und 2nd-Life-Geschäftsmodelle, Transparenz, Individualisierung und insbesondere Nachhaltigkeit für das Luxussegment deutlich relevanter.
• Dies führt dazu, dass insbesondere die Konsumentengruppe der LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) als Zielgruppe für das Luxussegment zielführend werden. LOHAS verfügen über eine hohe Kaufkraft, welche sie gerne auch in Luxus und Genuss investieren, dieser muss jedoch ethisch vertretbar sein.
• Das Prinzip der Nachhaltigkeit besagt im Ursprung, dass nicht mehr verbraucht (abgebaut) werden darf als nachwachsen kann. Im Wirtschaftskontext übersetzt, bedeutet Nachhaltigkeit, nicht Gewinne zu erwirtschaften die dann in Umwelt- und Sozialprojekte fließen, sondern Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften.
• Das auf diesem Prinzip basierende Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit erfordert die Einhaltung ökologischer, ökonomischer sowie sozialer Anforderungen. Erreicht werden können diese durch
Effizienz-, Konsistenz- und Suffizienzstrategie.
• Es wird erwartet, dass die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zukünftig auch für kleine- und mittelständische Unternehmen greift. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen sich die Unternehmen konkret mit den Anforderungen an die nicht-finanzielle Berichterstattung auseinandersetzen und Konzepte zur Nachhaltigkeit vorlegen können.
• Aufgrund von elementaren soziokulturellen Umwälzungen entsteht eine zunehmende Akzeptanz und Befürwortung des Nachhaltigkeitsprinzips, welche in einem Bedürfnis nach entsprechenden Konsumformen mündet.
• Die Verschmelzung von Nachhaltigkeit und höchsten Ansprüchen an die eigenen (Luxus-) Produkte auch über den „nachhaltigen“ Aspekt hinaus bildet die Grundlage einer hohen Glaubwürdigkeit des Handelns und stellt das Fundament für einen authentischen Auftritt des Unternehmens dar.